https://www.blaetter.de/ausgabe/2025/mai/zwischen-christdemokratie-und-rechtspopulismus
Wie die Merz-Union ideell schlingert und schrumpft >>Mai 2025
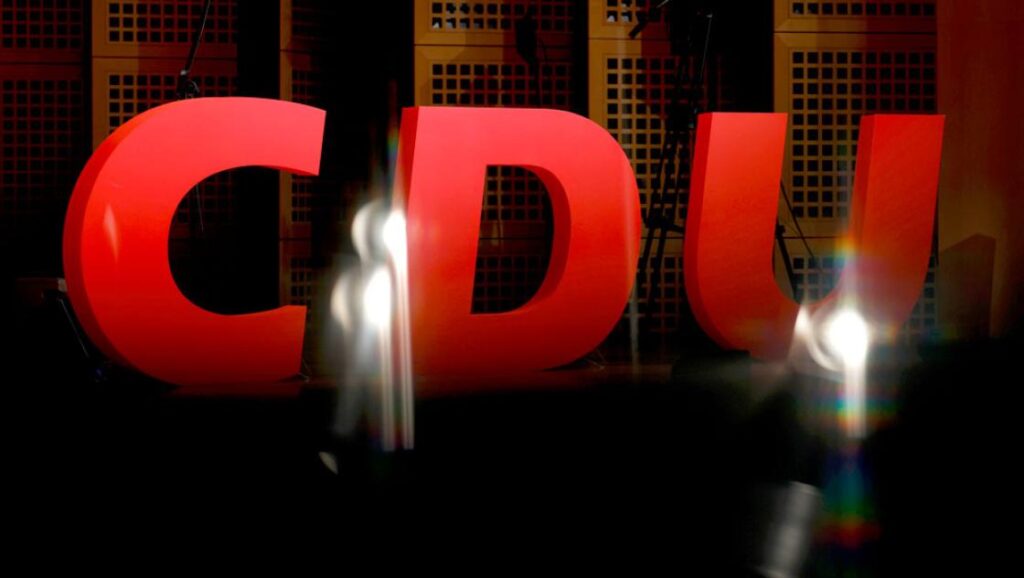
Ernst-Wolfgang Böckenfördes Diktum „Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann“, lässt sich auch auf Parteien anwenden. Als Scharnier zwischen Gesellschaft und Staat wirken sie laut Artikel 21 GG an der politischen Willensbildung des Volkes mit – indem sie politisch bilden, führen und das hierzu geeignete Personal rekrutieren. Die Besetzung der Parteispitzen ist damit die Achillesferse nicht nur der Parteien selbst, sondern auch der Demokratie. Oder im Volksmund: „Der Fisch stinkt vom Kopf her.“
Das heißt: Personelle Missgriffe können nicht nur die Popularität bei den Wählern mindern, sondern nachhaltig Schaden an der „Seele“ einer Partei verursachen und diese bis zur Unkenntlichkeit verändern. Die Degeneration der „Grand Old Party“ unter Donald Trump und der Tories unter Boris Johnson, die die Briten 2016 in den schon bald mehrheitlich bereuten EU-Austritt trieben, stechen als Beispiele besonders ins Auge. Aber auch in anderen Ländern ist eine Krise speziell des Konservatismus unübersehbar: autoritäre Radikalisierung, Angriffe auf die Gewaltenteilung, auf freie Medien und bürgerliche Grundrechte, Erstürmung von Parlamenten bei Machtverlust, kurzum: das Abgleiten in den Rechtspopulismus oder gar -radikalismus.
CDU und CSU sollten dagegen eigentlich gefeit sein. Denn ihre Gründungsidee war dezidiert nicht konservativ oder gar rechts, sondern christlich-demokratisch und christlich-sozial, nachdem in der Weimarer Republik DNVP und DVP als Vertretungen des deutschen Konservatismus in der Abwehr des Nationalsozialismus völlig versagt hatten. Beim Durchbruch der NSDAP in den Wahlen 1930 von 2,6 auf 18,3 Prozent halbierten sich die deutschnationale DNVP gegenüber 1928 auf 7 Prozent und die wirtschaftsnahe DVP auf 4,5 Prozent, so gering war die Immunität ihres „bürgerlichen“ Anhangs gegenüber den Rechtsextremen.1 Beeindruckt durch die Stärke der Nazis – heute würde man betonen: „Sie sind ja demokratisch gewählt“ –, vor allem aber in der Hoffnung, sie gegen den „Bolschewismus“ nutzen zu können, bewog eine rechtskonservative Kamarilla den greisen Reichspräsidenten, die „Brandmauer“ gegen die Braunen aufzugeben. Hitlers Vizekanzler wurde der vom Zentrum abtrünnige Baron Franz von Papen, Wirtschaftsminister der Deutschnationale Alfred Hugenberg, dessen Medienimperium die Republik durch Dauerhetze mit sturmreif geschossen hatte. Was für ein politisches und moralisches Desaster der Konservativen – und leider bietet es beunruhigende Déjà-vus zu heutigen Trends und Verhaltensmustern.
Nach der durch einseitig antilinke „Bürgerlichkeit“, politische Dummheit und Charakterlosigkeit vorprogrammierten und noch schlimmer als vorstellbar eingetretenen „deutschen Katastrophe“ (Friedrich Meinecke) zwischen 1933 und 1945 schlüpfte das, was vom toxischen Weimarer Konservatismus übrig geblieben war, kleinlaut mehrheitlich beim überkonfessionellen neuen Projekt der „Christlichen Demokratie“ unter.2 Man wolle sich „auf die kulturgestaltenden sittlichen und geistigen Kräfte des Christentums besinnen und diese Kraftquellen unserem Volk immer mehr erschließen“, hieß es 1945 im Berliner CDU-Gründungsaufruf. Das Wort „konservativ“ kam in der Gründungsprogrammatik gar nicht vor, sondern tauchte erst im Ludwigshafener Programm 1978 auf, und das auch eher beiläufig: „Freiheit und Menschlichkeit sollen sich nicht wieder in verhängnisvoller Gegnerschaft zwischen sozialen, liberalen und konservativen politischen Strömungen verlieren.“
Die Lehren und Tabus aus der unheiligen Allianz von Rechtsextremen, Konservativen und wirtschaftsnahen Rechtsliberalen hielten mehr als zwei Generationen lang, abgesehen von ephemeren Landtagswahlerfolgen von NPD, DVU und „Republikanern“ (die 1989 auch ins Europaparlament einzogen). Erst der von konservativen Bildungsbürgern und Wirtschaftsexperten 2013 gegründeten AfD gelang wieder ein konservativ-rechtsextremes Joint venture, und zwar nicht erst als Koalition „der nationalen Erhebung“, sondern gleich als gemeinsame Partei. Der Versuch mehrerer AfD-Parteivorstände, Extremisten auszuschließen, verfing dabei immer weniger, die Kräfte verschoben sich zugunsten des faschistoiden Flügels, ablesbar am Sturz der Vorsitzenden Lucke 2015, Petry 2017 und Meuthen 2022. Die Zauberlehrlinge jammerten, sie hätten mit der Gründung der AfD „ein richtiges Monster erschaffen“ (Hans-Olaf Henkel). Ökonomische Expertise verleiht eben nicht automatisch politische Klugheit. Dies lässt sich auch im Wirtschaftsflügel der Union beobachten, wo Konservatismus und Rechtsliberalismus grassieren und eine Transformation der Parteiidentität betreiben.
Hierbei bevorzugt der federführende konservative und wirtschaftsliberale Parteiflügel nicht ohne Grund die Chiffre „bürgerlich“ gegenüber „konservativ“: Eine 2012 gestellte Allensbacher Umfrage ergab, dass die Vorstellungen der Bevölkerung von Positionen eines konservativen Politikers weit negativer ausfielen als die von Positionen eines christlichen. Von diesem erwarteten die Deutschen in der Politik viel häufiger, „dass er sich für sozial Schwache einsetzt“, „für Freiheit eintritt“, „weltoffen, tolerant ist“, „sich für den Umweltschutz einsetzt“. Offenbar identifiziert die Bevölkerung das Christliche nicht einfach mit Kirche, sondern hat eine eigene Idee davon. Und die ist auch nach neueren Daten recht positiv: Die Wertschätzung des Christentums geht weit über die Gruppe der kirchennahen Bürger hinaus. Im Vergleich der Wahrnehmung von Weltreligionen und Weltanschauungen „als Bereicherung“ lag nach dem Religionsmonitor der Bertelsmann-Stiftung das Christentum 2022 mit 43 Prozent in Westdeutschland und 33 Prozent in Ostdeutschland vor dem Buddhismus (41/34) an der Spitze.3
Wie aus Merz-Fans Ex-Fans wurden
Bei einem Konservativen vermutet die Bevölkerung weit mehr als beim Christen, „dass er von Ausländern verlangt, sich weitgehend an die deutsche Kultur anzupassen“ und fordert, „dass die Arbeitslosenunterstützung deutlich niedriger ist als das Einkommen eines Berufstätigen“, „dass er patriotisch, stolz auf sein Land“ und „gegen die rechtliche Gleichstellung von homosexuellen Paaren ist“ – also für das steht, was radikal die AfD und abgeschwächter auch weite Teile der neuen Merz-Söder-Union verkörpern.
Dass ein „C wie Conservativ“ (statt christlich) zum Malus bei den Wählern werden kann, haben inzwischen wohl auch die meisten konservativen Merz-Fans begriffen, die während der Koalitionsverhandlungen nicht selten zu Ex-Fans wurden. Nach der zunächst deutlich konservativeren Neuausrichtung unter ihrem Idol ist bei der Bundestagswahl die erwartete und vom „Merzias“ einst verheißene Rallye der CDU-Umfragewerte gen 40 Prozent nicht nur ausgeblieben, sondern das Gegenteil eingetreten: Mit 28,5 Prozent fuhr die Union das zweitschlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte ein, und das aus der Opposition heraus gegen eine höchst unbeliebte Regierung. Für diese Wahlschlappe wäre Annegret Kramp-Karrenbauer vermutlich abgelöst worden. Die Union blieb nicht nur weit unter der von Generalsekretär Linnemann vorgegebenen Zielmarke von 35 Prozent für ein „gutes Ergebnis“, sondern auch klar hinter dem schwächsten Wahlergebnis Angela Merkels von 2017 mit 32,9 Prozent zurück.
In der Flüchtlingskrise 2015 waren die substanziellen Differenzen zwischen „christlich-demokratisch“ und „konservativ“ offenkundig geworden: Kanzlerin Merkel agierte im Einklang mit den Kirchen und weiten Teilen der Zivilgesellschaft humanitär und proeuropäisch, „Konservative“ empörten sich dagegen. Die christliche Mitleids- und Solidarethik war plötzlich ungemütlich geworden. Mancher realisierte erst jetzt, dass das „C“ sich nicht als Sahnehäubchen auf einer sogenannten „gutbürgerlichen“ Existenz eignet, bei der es vor allem eines zu bewahren gilt: das eigene Vermögen und die Allgemeingültigkeit eigener kultureller Gewohnheiten. Christ ist man immer auch für andere, nie nur für sich selbst und die „Eigenen“.
Eine Partei erhebt mit dem „C“ also einen bisweilen anstrengenden Anspruch. Manche in der CDU scheinen gerade dies zu fürchten – und nicht nur, aus mehr opportunistischen Gründen, Nachteile durch die Säkularisierung. Der Mainzer Geschichtsprofessor Andreas Rödder, Leiter der 2021 von ihm gegründeten liberal-konservativen Denkfabrik Republik21 und 2022/2023 Vorsitzender der CDU-Grundwertekommission, gab in einer Analyse der Bundestagswahl 2021 zu bedenken, das „C“ könne in einer sich entchristlichenden Gesellschaft zur Barriere für Nichtchristen werden und „Exklusivität signalisieren, wo die Union eigentlich auf Integration“ ziele. Es gebe deshalb „gute Gründe für eine Flurbereinigung in der Namensfrage“, durch Streichung des C oder „Namenszusatz“. Was man früher vielleicht aus dem liberalen Spektrum der Union erwartet hätte, kam nun von einem prononciert Konservativen. Da war sie wieder, die Sollbruchstelle des einst gern verkoppelten Attributs „christlich-konservativ“. Die konservative Wertetrias „Arbeit, Familie, Vaterland“ ist eben nicht kongruent mit jener des Christentums: „Glaube, Liebe, Hoffnung“. Der direkte Angriff auf die christliche Identität der CDU erfolgte damit ausgerechnet durch den Parteiflügel, der Angela Merkel lautstark eine „Entkernung“ der Partei vorgeworfen hatte. Zwar konnte er abgewehrt werden, insbesondere durch Vertreter des Evangelischen Arbeitskreises (EAK), doch der Grundsatzkommission unter dem langjährigen Vorsitzenden der CDU-Mittelstandsunion (MIT) und heutigen Generalsekretär Carsten Linnemann gelang es, dem Christlichen im Programm einen individualistischen und wirtschaftsliberalen Spin zu geben. Vor allem aber wurde das Christliche durch die Erfindung einer Zweitidentität als „bürgerliche“ Partei relativiert – schon deshalb ein verwirrendes Unterfangen, weil „bürgerlich“ im behaupteten republikanischen Sinn, also des Citoyen, nicht des Bourgeois, mindestens auch FDP, Grüne und SPD sind.
In der vom CDU-Bundesparteitag im September 2022 gebilligten „Charta“ als Basismodul des 2024 verabschiedeten Programms wurden die Grundwerte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität zunächst nicht mehr nach und damit im Licht der Verantwortung vor Gott und des christlichen Menschenbildes als Dreh- und Angelpunkt der Programmsystematik entfaltet, sondern den anthropologischen Prämissen vorangestellt. Gott kam nur in einem Relativsatz vor, das christliche Menschenbild skizzierte erst der zweite Abschnitt, nach der Proklamation der Grundwerte. Die Gottesebenbildlichkeit des Menschen fehlte sogar ganz. Nur durch intensive Bemühungen, wiederum wesentlich des EAK, aber auch der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), konnten die Konstruktionsfehler im Grundsätzlichen teilweise revidiert werden. Allerdings blieben die christlichen Zentralbegriffe wie Gott, Kirche, Nächstenliebe und christlich im neuen Programm erheblich reduziert. Das Christliche firmiert nun fast nur noch als identitätspolitische Charakterisierung der Partei und der Landesprägung bzw. der geforderten „Leitkultur“, während CDU-Positionen in konkreten Politikbereichen fast nie aus dem „C“ abgeleitet werden.
Merz’ Konservatismus zahlte sich jedoch keineswegs für die Partei aus, im Gegenteil: Bei den jungen Frauen (18-24 Jahre) erreichte die nun wieder sehr männlich aufgestellte Union bei der Bundestagswahl nur 11 Prozent und schnitt damit schlechter als sämtliche ins Parlament eingezogene kleinere Parteien ab; bei den jungen Männern blieb sie mit 18 Prozent (auch in der nächst höheren Altersgruppe 25-34 Jahre) deutlich hinter der AfD (26 Prozent) zurück. Unter dem als Anti-AfD-Geheimwaffe gestarteten, schneidigen Macherteam Merz/Linnemann verlor die Union eine Million Wähler an die AfD, aber auch fast 300 000 Wähler an BSW und Linke. Und obwohl die Union unter dem Duo vom Wirtschaftsflügel wohl nie mehr FDP-Profil hatte, wechselten fast 900 000 FDP-Wähler zur AfD statt zur Union. Kurzum: Merz’ „AfD halbieren“-Projekt ist krachend gescheitert. Offenkundig hatte der Kanzlerkandidat die Wählerklientel der radikalen Rechten in ihrer Radikalität massiv unterschätzt.
Damit stehen Merz und Linnemann nicht allein: Auch viele andere Konservative sehen in AfD-Wählern nur etwas ungezogenere Verwandte, die im Grunde das Richtige wollen, aber aus Frustration über die Stränge schlagen und Protest wählen. Der rechte CDU-Flügel projiziert seine eigene Unzufriedenheit mit den Merkel-Jahren in eine AfD-Klientel hinein, die sich demoskopisch großenteils xenophob, nationalistisch-chauvinistisch, autoritär bis Diktatur-geneigt, für Verschwörungsmythen anfällig, fanatisch islamfeindlich, manifest oder latent antisemitisch, sozialdarwinistisch und gewaltaffin zeigt. Sie passt also schlicht gar nicht zur Union. Die AfD speiste sich bislang mehrheitlich auch nicht aus der Wählerschaft der CDU/CSU, sondern aus dem Reservoir der Nichtwähler zuzüglich rechter Kleinparteien sowie aus dem linken Spektrum. Diese AfD-Wählerschaft durch Selbstbezichtigung der Demokraten zu rechtfertigen, sich nötiger Kritik an ihr zu enthalten, AfD-Kampfbegriffe zu übernehmen und demagogisch „das Stinktier überstinken“ zu wollen, hat mehr zementierende und forcierende Effekte auf den Rechtsrutsch, als dass es ihm Einhalt gebieten könnte.
Trumpeske Tendenzen und serielle Entgleisungen
Anfang 2024 gab eine Gruppe junger Wissenschaftler um den damaligen Bundesvorsitzenden der Jugendorganisation des Arbeitnehmerflügels (JCDA) Benedikt Groß der Parteiführung Kontra.4 Unter der Überschrift „Essentials der Christdemokratie“ beklagte sie, das „C“ werde „sogar aus der Mitte der strategischen Planungsriege der Partei infrage gestellt“; die deutsche Christdemokratie zeige sich „desorientiert und erlebt wahrscheinlich ihre schwerste Krise in der Geschichte der Bundesrepublik“. Wo das Konservative „überbetont wird und nachträglich in den Gründungsgedanken der CDU eingeschleust werden soll“, gelte es, auf der Basis christlicher Sozialethik mit einem „anthropologisch reflektierten, haltungsbezogenen Konservatismus“ dagegenzuhalten, „der gemäßigt und gezähmt durch die anderen ideenpolitischen Säulen deutlich zum rechten Rand hin abgrenzbar ist“; das Konservative müsse „eingehegt und vom Christlichen her gedeutet werden und keinesfalls umgekehrt“.
Namentlich beriefen sich die Autoren auf frühere CDU-Vordenker wie Norbert Blüm, Heiner Geißler, Klaus Töpfer und Werner Remmers. Alle drei Wurzeln der Christdemokratie zu entfalten, sei „Populismusprophylaxe“ – die die aktuelle Parteiführung nötig zu haben scheine, denn Schritte in Richtung ‚Grand Old Party’ wurden „unlängst unternommen, vor allem habituell“. Eine „Haltung politischer Liebe“ verbiete es dagegen, „herabwürdigend von Menschen und Menschengruppen zu sprechen“.
Die Warnung vor Abwegen wie denen der Trump-Republikaner mag alarmistisch klingen, doch so „bürgerlich“ wie im neuen Programm beansprucht, kommt das Team Merz im Habitus bisher tatsächlich nicht daher. Jedenfalls wenn man unter „Bürgerlichkeit“ dezentes Auftreten, Allgemeinbildung, differenziertes Argumentieren, Redlichkeit und Mäßigung versteht. Der Parteichef selbst manifestierte dagegen die Achsenverschiebung der CDU durch eine Reihe von Entgleisungen, Mitstreiter und Unions-Influencer folgten im Netz. Dazu nur einige Beispiele in Stichworten: Merz‘ kontrafaktische Selbstverortung in der „gehobenen Mittelschicht“; Migrantenkinder als „kleine Paschas“; „Sozialtourismus“ von Ukrainern; Terminknappheit in Zahnarztpraxen durch aufwändige Gebisssanierungen für Migranten; Polemik gegen Rundfunksender als „Volkserziehungsanstalten“ samt der spöttischen Drohung, sich mit deren Journalisten „im Verlaufe dieses Parteitages besonders liebevoll (zu) beschäftigen“; eine „Alternative für Deutschland mit Substanz“ zu sein, die kommunal mit der AfD „gemeinsam gestalte“; „brillant“ für Claudia Pechsteins ressentimentgeladenes Gestammel beim „Grundsatzkonvent“ in Berlin; „bravourös“ für Söders Umgang mit der Aiwanger-Affäre; „Nicht Kreuzberg ist Deutschland, Gillamoos ist Deutschland“; Lob für Thilo Sarrazins Weitsicht, Kritik an seinem SPD-Ausschluss: die Falschaussage: „Das Wort Brandmauer hat nie zu unserem Sprachgebrauch gehört“ – und vor allem die Verteufelung der Grünen als „Hauptgegner“ (Merz), „vaterlandslose Gesellen“ (Klaus-Peter Willsch) ohne „Bayern-Gen“ (Söder), Treiber einer „Politik gegen das Volk und unsere Nation“ (Erwin Rüddel) mit „Energie-Stasi“ (Mario Voigt).
Erinnert werden muss auch an die Forderung einer „konservativen Revolution“ (Alexander Dobrindt) im Jahr 2018 und die Reise zu Rechtsaußen Ron DeSantis (Andreas Scheuer, Dorothee Bär, Florian Hahn); die Anregung „physischer Gewalt“ gegen irreguläre Migranten (Jens Spahn), die viel zu lange Duldung Hans-Georg Maaßens, den sogar Karl-Josef Laumann 2021 noch „im CDU-Spektrum“ sah und dessen Ausfälle man „nicht überbewerten“ (Armin Laschet) solle; Retweets und Interviews mit rechten Agitationsmedien wie „Tichys Einblick“, „Nius“ und „The Republic“; Gesetzgebung mit Stimmen der Höcke-AfD in Thüringen, die man sogar im Plenum einforderte.
Am Ende des aufgeheizten Wahlkampfs standen Merz’ Ausfälle gegen „linke und grüne Spinner“, die nicht „alle Tassen im Schrank“ hätten, und seine Falschaussage, die „Antifa“ sei nach der Ermordung Walter Lübckes unsichtbar geblieben (woraufhin Lübckes Witwe scharf widersprach) – sowie seine mit dem Autoschlüssel wedelnde Unterstellung, SPD und Grüne würden in Koalitionsverhandlungen bei der Aussicht, weiter im Dienstwagen fahren zu können statt zu Fuß zu gehen, gewiss „ziemlich sinnlich und nachdenklich“. Was für ein Niveau! Man erfährt dadurch mehr über den Horizont des Sprechers selbst als über die Gescholtenen. Notabene: All dies geht inzwischen in der CDU durch, bei nur vereinzeltem Widerspruch moderater Parteivertreter.
Merz, Klöckner und das Propagandanarrativ der Rechtsradikalen
Immer wieder bedienten Merz und sein Team das zentrale Propagandanarrativ der Rechtsradikalen: angebliche diktatorische Tendenzen unserer Demokratie. Etwa am 8. März 2024 auf „X“, unter Berufung auf Friedrich August von Hayek: „Was wir in Berlin mit SPD und Grünen erleben, ist das Gegenteil dessen, was Freiheit und Innovation ermöglicht. Es ist der Weg in die Knechtschaft.“ In der Debatte um ein AfD-Verbot auf Überlegungen von SPD-Chefin Esken angesprochen, nannte Merz die Idee, dass „man eine Partei, die in Umfragen an die 30 Prozent heranreicht, einfach verbieten kann… eine beängstigende Verdrängung der Wirklichkeit“ – und vereinfachte mit dem „einzig wirksamen Konzept“: „Die Politik muss vernünftige Lösungen für die Probleme hinbekommen, dann wird auch die AfD wieder kleiner.“ So kann man die Wahl Rechtsradikaler auch ungewollt legitimieren – wie die einstige Landwirtschaftsministerin und heutige Bundestagspräsidentin, Julia Klöckner, mit ihrem unsäglichen Instagram-Post: „Für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht die AfD wählen. Dafür gibt es eine demokratische Alternative: die CDU!“ Als die Enthüllung rechtsextremer Ausweisungsfantasien gegen Menschen mit Migrationshintergrund 2024 Millionen Demonstranten auf die Straßen trieb, hielt Merz es für angebracht, bei Caren Miosga zu warnen: „Wenn wir AfD-Wähler zurückgewinnen wollen, dann dürfen wir sie nicht beschimpfen… Die Nazikeule bringt uns nicht weiter, wenn wir das Problem lösen wollen.“ Er setzte sogar noch eins drauf: „Will Frau Esken dann auch noch die Union verbieten, wenn wir auf die Probleme hinweisen, die der SPD nicht so angenehm sind?“ – ein Steilpass für AfD-Funktionäre, die ihre Partei gern als Opfer eines autoritären Regimes inszenieren.
Einer „Rechtsstaatspartei“ unwürdig war es auch, dass ihr Vorsitzender 2024 auf die Blockade des grünen Vizekanzlers und Wirtschaftsministers Robert Habeck durch einen wütenden Mob am Fähranleger im nordfriesischen Schlüttsiel (auf der Rückfahrt von der Hallig Hooge) nur mit einem milden „nicht in Ordnung“ reagierte, um dann gleich zu relativieren und das Aggressionsopfer zu belehren: „Aber er sollte das nicht moralisch überhöhen. Der ganz große Teil der Bauernproteste hat friedlich und ohne irgendwelche Vorkommnisse stattgefunden.“ Man kann sich die Empörung des dünnhäutigen CDU-Chefs lebhaft vorstellen, wäre er selbst Opfer solcher Übergriffigkeit geworden.
Merz und Söder trieben durch geschürte Empörung ganz bewusst die Leute gegen die Ampelregierung auf die Bäume – und bekommen sie nun, da in den Koalitionsverhandlungen doch wieder schwierige Kompromisse gefragt waren, nicht mehr herunter. Das kurzfristige Nutzenkalkül, mit Überzeichnungen, Verdrehungen, teils sogar Falschinformationen Stimmung machen und Stimmen abschöpfen zu wollen, fällt nun erwartbar auf die Union zurück wie ein Bumerang. Ihre Umfragewerte und die von Merz persönlich sinken weiter – was auch kein Wunder ist angesichts der Diskrepanz zwischen Wahlversprechen und Beschlüssen nach der Wahl, insbesondere zur Staatsverschuldung.
Die praktisch nutzlose Bundestagsinitiative „Zustrombegrenzungsgesetz“ (schon sprachlich ein Missgriff, denn es geht um Menschen, nicht Naturgewalt) verschreckte besonnene Mitte-Wähler, mobilisierte die Linke und trug zur unerwarteten Blüte der Linkspartei bei, die sich auf Demonstrationen überall im Land als „antifaschistische Kraft“ auch gegen die Union profilieren konnte. Der Anteil der Menschen, die mit CDU-Wählern „nichts zu tun haben möchte(n)“, verdoppelte sich laut Wahlanalyse der Adenauer-Stiftung nahezu: seit 2019 von 7 auf 13 Prozent und – welch Ironie der Geschichte – auf Augenhöhe mit Flüchtlingen (14).
Die Kompetenz, „die wichtigsten Probleme Deutschlands lösen“ zu können, wurde bereits im Dezember 2024 – also noch vor der Bundestagsabstimmung gemeinsam mit der AfD – bei Infratest dimap nur von 29 Prozent der Union zugesprochen. Das waren kaum mehr als unter Kanzlerkandidat Laschet (26) und weit weniger als unter Angela Merkel bei ihrer letzten Bundestagswahl 2017 (49), ja sogar als bei Kohls und Stoibers verlorenen Wahlen 1998 und 2002 (32 bzw. 34).5 Merz ging mit einer Ablehnung von 59 Prozent, die mit ihm „weniger“ oder „gar nicht zufrieden“ waren, in die Wahl und kam damit kaum besser weg als Robert Habeck mit 61 Prozent – trotz der jahrelangen auch von Merz und Söder angeheizten Kampagne gegen dessen angeblichen „Heizhammer“ (Bild), das Gebäudeenergiegesetz. „Ist sympathisch“ sagte nicht einmal jeder Vierte über den Unions-Kanzlerkandidaten und nur 37 Prozent der Deutschen vermuteten, „Friedrich Merz würde es als Kanzler besser machen“.
Misslungene geistige Führung: »Leitkultur« von Merz bis Precht
Merz‘ Vorgängerin Angela Merkel antwortete 2010 bei Anne Will auf die Frage nach der Ausrichtung ihrer Politik: „Mal bin ich liberal, mal bin ich konservativ, mal bin ich christlich-sozial“ –, was ihr fälschlicherweise als Beliebigkeit ausgelegt wurde. Ein Christ muss sich aber nun einmal, je nach Thema, liberal, konservativ oder sozial positionieren. Das Christliche dient jedem der drei Attribute als Deutungsschlüssel, es steht wie ein Vorzeichen vor der Klammer der politischen Strömungen. Es macht nicht nur, wie die „Drei-Wurzel-Lehre“ der Parteirhetorik („Liberal, konservativ und christlich-sozial“) glauben machen kann, beim Sozialen einen Unterschied („Gerechtigkeit teilt, Liebe teilt zu“), sondern auch beim Liberalen und beim Konservativen. Der EAK-Vorsitzende, Thomas Rachel, brachte es so auf den Punkt: „Das C in der CDU sorgt dafür, dass das Liberale menschlich bleibt, dass das Soziale nie zum Sozialismus wird und dass das Konservative nie in eine Blut- und Bodenideologie abgleitet.“ Das C sei „deswegen eine klare Grenze nach Rechtsaußen“.
Statt sich für das Alleinstellungsmerkmal eines christlich inspirierten Politikansatzes starkzumachen, sieht geistige Führung à la Merz dagegen so aus: „Unsere Kinder fragen: Wie wird unsere Zukunft? Auf der einen Seite gibt es viel Auswahl, auf der anderen viel Verunsicherung. Deswegen braucht es wieder mehr Bindung. Wir nennen die Dinge beim Namen und schreiben Heimat, Patriotismus und Leitkultur ins Grundsatzprogramm.“6
Einmal abgesehen davon, dass junge Menschen sehr viel konkretere Sorgen umtreiben, wie die Folgen einer überalternden Gesellschaft, die Klimakrise oder der Mangel an bezahlbaren Wohnraum7: Auf „Heimat, Patriotismus und Leitkultur“ setzen auch Trump, Orbán und Putin. Haben Christliche Demokraten im Wertediskurs nicht mehr, nicht anderes, Besseres zu bieten? Wieso wurden im neuen Grundsatzprogramm Gläubige einer anderen Weltreligion unter Verdacht gestellt, indem man ihre Zugehörigkeit zur Gesellschaft zunächst mit dem Sondervorbehalt verband: „Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland“ und dann, nach lebhafter Kontroverse und Korrektur, mit dem Sonderverdikt: „Ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland.“ Meint die Parteiführung etwa, dass man „unsere Werte“ bei „bio-“ oder „volksdeutschen“ Mitbürgern noch selbstverständlich voraussetzen kann, obwohl diese massenhaft Putin-Parteien nachlaufen und sich laut Mitte-Studie ein Viertel erwärmen kann für „eine einzige starke Partei, die die Volksgemeinschaft insgesamt verkörpert“? Gehören die noch zu „uns“? Haben Merz und sein stets überagiler Generalsekretär (Leitmotto: „Einfach mal machen“), der Richard David Precht für einen „ganz ganz großen Philosophen“ hält, „über den noch in 200, 300 Jahren gesprochen wird“, den „biodeutschen“ Angriff auf die liberale Demokratie, nämlich seitens der AfD, überhaupt verstanden?
Wahrscheinlich ist die CDU im Parteienspektrum gerade die sich am meisten von ihren Fundamenten entfernende Formation, ohne dass ein Großteil ihrer Mitglieder dies überhaupt erfasst. Linke irren mit dem Vorwurf, der bald 70-jährige Parteichef wolle die CDU in die ihn prägenden 1980er Jahre zurück katapultieren; eher zieht die Partei gleich mit der Verplumpung anderer Mitte-rechts-Parteien des Westens. Der in den 80er Jahren die Union prägende, geschichtsbewusste Helmut Kohl, der Merz „ein politisches Kleinkind“ nannte, würde die aktuelle personelle und programmatische Neuaufstellung der Partei wohl kaum gutheißen. Und ebenso wenig sein Vorgänger Konrad Adenauer, der die CDU beim Bundesparteitag 1962 ganz bewusst von Parteien abgrenzte, die „nur Stände vertraten“ und dabei neben Arbeiter- oder Bauernparteien auch eine „Mittelstandspartei“ nannte als das, was die CDU gerade nicht werden sollte.
Zwar mag es bei den verbliebenen der, insgesamt abschmelzenden Stammwählern der Union – darunter viele Senioren – noch immer ein Grundvertrauen unabhängig vom aktuellen Politikangebot der Partei geben und eine Art „Gnade des weniger genauen Hinschauens“. Doch sich wiederholende moralische Enttäuschungen können heute eher Wechselwahl auslösen als früher. Und für Enttäuschung hat die Union mit ihrem Wortbruch durch die radikale Reform der Schuldenbremse nach der Wähl längst gesorgt. Dabei hätte Friedrich Merz eine Reform der Schuldenbremse bereits vor der Wahl haben können, und das mit einer unbestreitbar demokratischen Zweidrittelmehrheit.
Angesichts der immensen Herausforderung der liberalen Demokratie durch innere und äußere Feinde, von der AfD über Putin, Trump und Xi Jinping, bis zu den Folgen des Klimawandels, darf eine Partei, deren Gründungsimpulse bis in antitotalitäre Widerstandsgruppen und in die Folterkeller der Gestapo zurückreichen, jetzt nicht „zu klein“ denken und Wesentliches übersehen, nur um kurzfristig einen Punkt bei der vermeintlich „bürgerlichen“ Wählerklientel zu machen – wie mit der Migrations-Abstimmung gemeinsam mit der AfD im Bundestag oder auch bei der Senkung der Grunderwerbssteuer in Thüringen um 1,5 Prozent unter Inkaufnahme (mindestens) stillschweigender Kooperation mit den Rechtsradikalen.
Besonders gefordert ist hingegen Kompromissfähigkeit gegenüber allen anderen demokratischen Parteien, gerade auch den von Markus Söder regelrecht obsessiv verteufelten Grünen mit ihrem christlich konnotierten Thema der Nachhaltigkeit beziehungsweise der „Bewahrung der Schöpfung“ – zumal, wenn man in mehreren großen Bundesländern erfolgreich und „geräuschlos“ mit ihnen koaliert.
Konrad Adenauer, im März 1961 von einer Gruppe führender Katholiken auf das damals schon „verblassende C“ im Parteinamen angesprochen, antwortete nach Aussage eines Zeitzeugen: „Die Christen müssen sich engagieren. Viele andere müssen uns wählen. Vor allem müssen Christen führen.“ Dies kann heute zwar nicht mehr bedeuten, dass das gesamte Führungspersonal einer C-Partei dezidiert religiös oder in der Systematik der christlichen Sozialethik intellektuell zuhause sein muss. Sinkt jedoch der Anteil solcher Personen unter eine kritische Schwelle oder wird Vertretern dieser geistigen und religiösen Tradition kaum noch Gehör und Einfluss gegeben, merken christliche Parteimitglieder und Wähler irgendwann, dass sie es nur noch mit einer historisch überkommenen leeren Hülle zu tun haben und die Partei ihre „Seele“ verloren hat.
Dann könnten sie entweder zu anderen Parteien abwandern, die zumindest Schnittmengen mit christlich-demokratischen Ideen haben. Oder sie gründen neu, um als zwar kleinere, aber authentische Gruppierung die große Tradition Christlicher Demokratie in Deutschland und Europa fortzusetzen.
1 In den Juli-Wahlen 1932 sank die DNVP nochmals auf 5,9 Prozent, die DVP auf 1,2. Weniger krass schrumpfte die SPD von 29,8 auf 21,6 Prozent, während die KPD von 10,6 auf 14,6 aufwuchs. Allein die mittige katholische Zentrumspartei blieb stabil um die 12 Prozent.
2 Die CDU entstand als politische Promenadenmischung: Von den Vorsitzenden regionaler und überregionaler Zusammenschlüsse der Unionsparteien bis 1950 kamen 23 aus dem Zentrum, 8 aus der (links-)liberalen DDP, 5 aus der DVP, je 3 aus der Bayerischen Volkspartei und der DNVP sowie 2 aus dem protestantischen Christlich-Sozialen Volksdienst (CSVD).
3 Es folgten das Judentum (33/30) und der Hinduismus (32/26), weit vor dem Atheismus (22/27) und dem Islam (19/17).
4 Im März-Heft 2024 der jesuitischen „Stimmen der Zeit“.
5 Die soziale Gerechtigkeit sahen 2025 sogar nur 20 Prozent der Wähler bei der Union gut aufgehoben.
6 Merz-Tweet vom 29.2.2024.
7 Nicht zuletzt dieses Thema bescherte der Linkspartei gerade bei Jüngeren ihren enormen Erfolg bei der Bundestagswahl.
